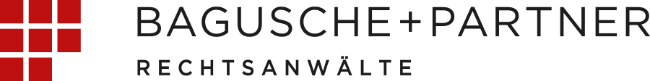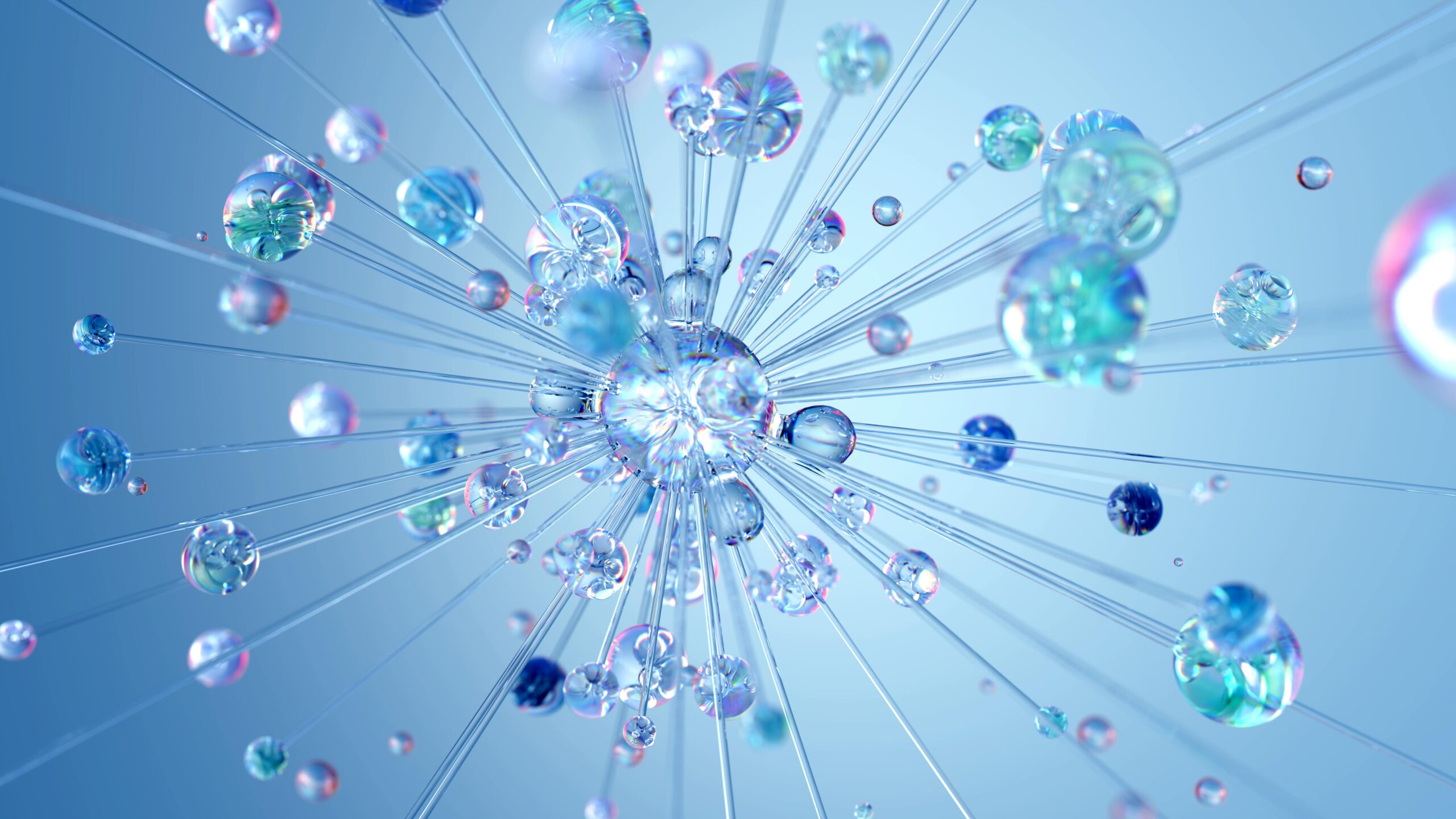Die Einführung von Künstlicher Intelligenz (KI) in Unternehmen ist längst keine Zukunftsmusik mehr. Ob automatisierte Bewerbervorauswahl, Chatbots zur internen Kommunikation oder Tools zur Effizienzanalyse – KI-Systeme halten zunehmend Einzug in den betrieblichen Alltag. Für alle Beteiligten bedeutet das: Neben technischen und ethischen Fragen rücken betriebsverfassungsrechtliche Beteiligungsrechte verstärkt in den Mittelpunkt.
1. KI im Sinne des Betriebsverfassungsgesetzes – was ist das eigentlich?
Seit dem Betriebsrätemodernisierungsgesetz 2021 enthält das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) erstmals ausdrückliche Verweise auf Künstliche Intelligenz. Eine Legaldefinition des Begriffs liefert das Gesetz leider nicht. Art. 3 Abs. 1 der europäischen KI-Verordnung (AI Act) bietet jedoch Orientierung: Demnach ist ein „KI‑System“ ein maschinengestütztes System, das für einen in unterschiedlichem Grade autonomen Betrieb ausgelegt ist und das nach seiner Betriebsaufnahme anpassungsfähig sein kann und das aus den erhaltenen Eingaben für explizite oder implizite Ziele ableitet, wie Ausgaben wie etwa Vorhersagen, Inhalte, Empfehlungen oder Entscheidungen erstellt werden, die physische oder virtuelle Umgebungen beeinflussen können.
Aus betriebsverfassungsrechtlicher Sicht ist insbesondere die Abgrenzung zu herkömmlicher Software entscheidend. Nur dort, wo eine echte Komplexität und Eigenständigkeit des Systems besteht – etwa bei generativer KI – greifen die speziellen Beteiligungsrechte des Betriebsrats. Arbeitgeber sprechen sich bereits für das Recht auf Hinzuziehung eines Sachverständigen nur bei starker KI (zur Abgrenzung) aus. Dies sollten die Betriebsräte nicht unangefochten lassen.
2. Informations- und Beratungsrechte nach § 90 BetrVG
Bereits bei der Planung des Einsatzes von KI-Systemen ist der Betriebsrat einzubeziehen. § 90 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG verpflichtet den Arbeitgeber, über den Einsatz von KI frühzeitig zu informieren und die entsprechenden Unterlagen vorzulegen. § 90 Abs. 2 BetrVG sichert das korrespondierende Beratungsrecht: Der Arbeitgeber hat mit dem Betriebsrat die Auswirkungen der Maßnahme – etwa auf Arbeitsinhalte, Arbeitsorganisation oder Qualifikationsanforderungen – zu erörtern.
Praxistipp: Man sollte diese Rechte nicht als bloße Formalität betrachten. Eine transparente Kommunikation schafft Vertrauen und ermöglicht eine spätere Umsetzung ohne Verzögerungen oder Konflikte.
3. Hinzuziehung von Sachverständigen nach § 80 Abs. 3 BetrVG
Geht es um die Einführung oder Anwendung von KI, gilt die Beiziehung eines Sachverständigen als generell erforderlich (§ 80 Abs. 3 Satz 2 BetrVG). Die technische Komplexität vieler KI-Systeme macht diese Unterstützung oft unverzichtbar. Der Betriebsrat muss die Erforderlichkeit in diesem Fall nicht mehr gesondert begründen – wohl aber mit dem Arbeitgeber eine Einigung über Person, Umfang und Kosten des Sachverständigen erzielen.
Diese Sonderregelung stärkt die Handlungsfähigkeit des Betriebsrats und schafft die Grundlage für eine qualifizierte Mitwirkung an der Gestaltung von KI-Prozessen.
4. Mitbestimmungsrechte nach § 87 Abs. 1 BetrVG
Je nach Einsatzform der KI-Systeme können mehrere Mitbestimmungstatbestände nach § 87 Abs. 1 BetrVG einschlägig sein:
- Nr. 6: Technische Überwachungseinrichtungen
Besonders relevant ist § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG, wenn KI-Systeme objektiv geeignet sind, Verhalten oder Leistung der Beschäftigten zu überwachen. Dabei kommt es nicht auf eine Überwachungsabsicht an – die Eignung zur Auswertung reicht aus. Beispiel: Eine Software, die Arbeitszeiten oder Klickverhalten analysiert, fällt regelmäßig unter diesen Mitbestimmungstatbestand. - Nr. 7: Gesundheitsschutz
Auch psychische Belastungen durch den Einsatz von KI (z. B. permanente Leistungskontrolle oder algorithmisch gesteuerte Arbeitsanweisungen) können ein Mitbestimmungsrecht nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG auslösen – insbesondere im Kontext der Gefährdungsbeurteilung nach § 5 ArbSchG. - Nr. 1: Ordnung des Betriebs
Dagegen greift § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG in der Regel nicht, wenn KI-Systeme lediglich als individuelles Arbeitsmittel dienen und keine kollektiven Verhaltensregeln oder Disziplinarfragen betroffen sind.
5. Weitere Beteiligungsrechte
- § 95 Abs. 2a BetrVG stellt klar, dass der Betriebsrat bei der Aufstellung von Auswahlrichtlinien (z. B. bei Einstellungen oder Kündigungen) auch dann mitbestimmen muss, wenn dabei KI-Systeme mitwirken.
- § 94 BetrVG greift, wenn KI bei Personalfragebögen oder Beurteilungssystemen zum Einsatz kommt.
- Auch die Mitwirkung bei Schulungen (§§ 96 ff. BetrVG) kann relevant werden, etwa wenn Beschäftigte im Umgang mit KI-Tools qualifiziert werden sollen.
Fazit
Die betriebsverfassungsrechtliche Einbindung des Betriebsrats ist bei der Einführung von KI-Systemen kein optionales Extra, sondern gesetzlich vorgesehen – und in der Praxis essenziell. Unternehmen tun gut daran, diese Rechte nicht nur formal zu beachten, sondern aktiv zu nutzen: Für rechtssichere Prozesse, höhere Akzeptanz und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit im Betrieb.
Unsere Kanzlei unterstützt Sie bei der strategischen Einführung von KI unter Berücksichtigung der Beteiligungsrechte des Betriebsrats – juristisch fundiert, praxisorientiert und auf Augenhöhe.
Bei Fragen zu diesem Thema sprechen Sie uns gerne an.
RA Leon Kolz